Gründe fürs Sprachenlernen gibt es viele. Die Frage ist nur: Was ist denn wirklich ein guter Grund für eine bestimmte Sprache? In diesem Beitrag gehe ich die am häufigsten genannten Anhaltspunkte, nach denen man entscheiden soll, welche Sprache man lernen soll, für dich durch und verrate dir schon jetzt: Es kommt ganz entscheidend auf dein ganz persönliches Warum an.
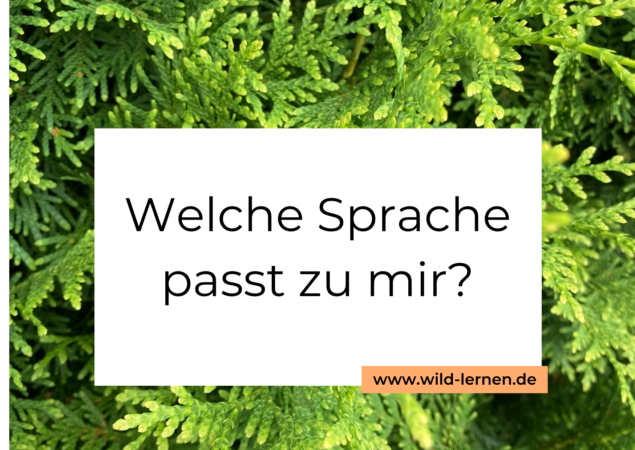
1. Nützlich, sinnvoll, praktisch
Frag mal das Internet, welche Sprache du lernen sollst. Du findest unzählige Artikel, die dir anhand „objektiver“ Nützlichkeit sagen wollen, welche Sprache du am besten lernen solltest. Einer der meistgenannten Anhaltspunkte für Nützlichkeit in diesem Kontext ist: Wie viele Menschen die Sprache sprechen. Dann findest du als nächstes meist Listen mit den Sprachen, die die meisten Sprecher haben.
Die Sprecheranzahl
Spontane Fragen: Wie viele Menschen kennst du von diesen Millionen, mit denen du diese Sprache sprechen möchtest? Und planst du überhaupt, das zu ändern? Wie soll dir dann die reine Anzahl der Menschen, die die Sprache sprechen, einen Grund geben, deine Zeit in das Lernen dieser Sprache zu investieren?
Ich persönlich glaube nicht, dass dich dieser Grund besonders weit tragen wird. Vielleicht ist eine hohe Sprecheranzahl ein schöner Bonus-Grund, wenn man ein tiefergehendes, persönliches Warum für die konkrete Sprache hat. Sie kann auch insofern ein Vorteil sein, als mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit unzählige Lernmaterialien und Kursangebote verfügbar sind.
Meiner Ansicht nach wird das allerdings nicht reichen. Gründe, die außerhalb der Person selbst liegen, liefern keine besonders gute Motivation. Weil, was passiert denn, wenn es mal schwierig wird (und das wird es!)? Sagst du dir dann: Da quäle ich mich durch, für die knapp 900 Millionen Mandarin-Sprecher?!
Du wirst ja auch gar nicht mit allen diesen Menschen kommunizieren können. Es sind einfach viel zu viele. Eine „kleine“ Sprache mit sagen wir mal 300.000 Sprechern, wie z.B. Isländisch, oder Westfriesisch mit ca. 500.000 Sprechern, hätte immer noch mehr Sprecher als du jemals persönlich ansprechen könntest.
Apropos kleine Sprachen
An dieser Stelle will ich dir die Vorzüge kleiner Sprachen nicht vorenthalten, denn die haben viel mehr zu bieten, als dir möglicherweise bewusst ist: Kleine Sprachen verfügen über eine spannende Kultur und Geschichte. Dies gilt insbesondere für Minderheitensprachen ohne eigenen Staat oder in Grenzgebieten, in denen die Region häufig auch zwischen zwei Ländern hin- und hergeschoben wurde.
Sprachsoziologisch befinden sie sich seit langem in Konkurrenz mit der Landessprache oder sogar noch weiteren Sprachen und weisen deshalb auch viele Veränderungen auf. Es gibt viele Lehnwörter und auch die Aussprache ist häufig angepasst an die Umgebungssprachen. Beide Aspekte erleichtern das Erlernen der Minderheitensprache.
Die Minderheitensituation bedeutet meist auch, dass die Sprecher eine sehr enge Gruppe bilden – die jedoch durchaus offen nach außen ist, sich über ehrliches Interesse freut und gerne unterstützt. Lernende können dadurch mit einem besonderen Zugehörigkeitsgefühl belohnt werden – was bei Sprachen, die „die ganze Welt“ spricht, schwierig werden kann.
Zusätzlich: Es soll ja auch Menschen geben, die nicht immer das machen wollen, was alle anderen auch machen. Deshalb sind viele Minderheitensprachen ein Geheimtipp für Sprachenlerner. Vielleicht ist eine von ihnen ja auch die richtige Sprache für dich?
Der praktische Nutzen
Zurück zum Thema. Ich will nämlich das Argument der Praktikabilität für die Frage, welche Sprache du lernen solltest, nicht ganz untergehen lassen, denn es ist eigentlich ein ziemlich guter Grund. Ich sehe das Problem hier eher in der Prämisse: Wer entscheidet denn überhaupt, ob eine Sprache nützlich ist? Leider wird es häufig so dargestellt und von vielen Menschen auch so wahrgenommen, als gäbe es da ganz klare, objektive Gründe, die für alle Menschen gelten.
So nach dem Motto: Englisch: nützlich. Irisch: nicht.
Außer natürlich, man lebt in Irland und braucht es zum Kommunizieren. Ganz genau, ihr merkt schon, genau hier fängt die Relativierung an und auf die kommt es an.
Denn alle Sprachen sind doch nützlich, sie alle werden zum Kommunizieren verwendet. Und wenn sie keinen praktischen Nutzen mehr für ihre Muttersprachler haben, sterben sie irgendwann aus (Selbst dann können sie einen praktischen Nutzen haben. Als Zeugnisse der Geschichte, als eigenes Untersuchungsobjekt im Hinblick auf Sprachveränderung…).
Wenn alle Sprachen nützlich sind, wie kommen wir dann an dieser Stelle mit der Frage weiter, welche Sprache wir lernen sollten?
Es kommt auf dich an.
Wie immer kommt es bei wild lernen auf dich und deine ganz individuelle Situation und deine Interessen an. Die Antwort auf die Frage nach der Nützlichkeit ist also: wenn die Sprache für dich ganz individuell einen praktischen Nutzen hat.
Vielleicht bestellt du regelmäßig bestimmte Produkte im Ausland und du hast jedes Mal Probleme beim Bestellen, weil du nichts verstehst? Oder du bekommst Informationen, die dich wahnsinnig interessieren nur in einer fremden Sprache? Vielleicht machst du auch immer wieder am gleichen Ort Urlaub und kennst ohnehin schon alle Nachbarn? Das sind Situationen, die sehr gute Gründe bieten, die Sprache zu lernen. Der Unterschied ist, dass es nicht darum geht, was „man“ denn so allgemein denkt, sondern dass es tatsächlich dir persönlich weiterhilft.
2. Karriere
Dann kommt meist das zweite Argument. Wenn du diese Sprache lernst, findest du später leichter einen Job. Oder: Die Sprache macht sich so gut im Lebenslauf.
Puh, wirklich? Eine Sprache lernen, weil es gut aussieht im Lebenslauf? Zum Abhaken sozusagen? Damit man angeblich mehr Chancen hat, wenn man sich bewirbt?
Es ist etwas anderes, wenn es um eine konkrete berufliche Notwendigkeit geht, z.B. du wirst ins Ausland entsendet oder sollst Kunden aus einem bestimmten Land betreuen. Auch hier gilt wieder: Wenn es für dich einen wirklichen praktischen Nutzen hat, sieht die Lage anders aus. Wenn du eine Sprache aber nur wegen einer abstrakten, möglicherweise irgendwann in der Zukunft relevanten Nützlichkeit, die nicht einmal garantiert ist, lernst, ist das wahrscheinlich nicht die richtige Sprache für dich.
Und mal abseits vom Sprachenlernen gedacht: Du willst doch auch eine berufliche Zukunft, die zu dir passt, oder? Deinen Traumjob planst du hoffentlich auch nicht ausschließlich nach der Vorstellung: Also da könnte es vielleicht in der Zukunft Arbeitsplätze geben.
Was bei einer auf die (etwaige) berufliche Zukunft gerichteten Überlegung auch zu kurz kommt, ist der Weg des Sprachenlernens. Mir ist es sehr wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, dass man den Prozess genießen kann.
Wenn man die Sprache einfach als Teil des Lebens sieht und für schöne Erlebnisse mit der Sprache sorgt, lernt man nicht nur die Sprache leichter, sondern bereichert sein ganzes Leben.
Natürlich ist es gut, auf Ziele hinzuarbeiten. Aber wenn du dabei auch noch eine gute Zeit haben kannst, weil du etwas machst, was dich wirklich interessiert, dann wähl doch diesen für dich passenden Weg.
Berufliche Vorteile
Und wer weiß? Vielleicht kannst du deine Traumsprache sogar sehr gut in der Zukunft beruflich einsetzen, denn es gibt auch Jobs, in denen Menschen mit Sprachkenntnissen in kleinen oder den meisten unbekannten Sprachen gebraucht werden. Nutze doch den Vorteil, dass die Konkurrenz nicht so groß ist. Mal ganz davon abgesehen, dass man sich im Bewerbungsprozess mit einer interessanten Sprachwahl von der Masse abhebt, wird man dir deine Passion für deine Traumsprache im Vorstellungsgespräch anmerken. Eine bessere Darstellung deines Engagements gibt es doch gar nicht.
3. Schwierigkeit der Sprache
Der nächste Grund, der überall als Maßstab dafür, welche Sprache du lernen solltest, zu finden ist: Wie einfach ist die Sprache zu lernen?
Mal ganz davon abgesehen, dass die Sprachwahl nach diesem Kriterium ziemlich eingeschränkt wäre, handelt es sich wieder um einen Grund, der viel mit einer Einstufung von außen und wenig mit dir selbst zu tun hat. Das geht schnell zu Lasten der Motivation.
Eine Frage, die man sich in diesem Zusammenhang stellen sollte, ist, was überhaupt „leicht“ oder „schwierig“ heißen soll. Ja, es gibt Einordnungen der Sprachen nach ihrem Schwierigkeitsgrad von der Muttersprache ausgehend. Der Faktor, nach dem diese Einordnung erfolgt, ist meist Zeit, also wie lange es dauert, ein bestimmtes Niveau zu erreichen. Es dauert möglicherweise einfach ein wenig länger, eine „schwierigere“ Sprache zu lernen.
Ist das ein guter Grund, sich für eine „leichtere“ Sprache zu entscheiden, nur weil es bei der anderen ein paar Monate länger dauert? Und wer sagt das eigentlich? Wenn ich mit der „leichteren“ Sprache nicht warm werde oder mich grundsätzlich nur schwer motivieren kann, wird es auch dort länger dauern, egal ob sie als „leichter“ oder „schwerer“ eingestuft wird.
Eine Sprache lernen, damit man später andere Sprachen leichter lernen kann?
Ein ähnliches Kriterium, nur in Richtung Praktikabilität gedreht, ist dieses: Diese Sprache wäre so praktisch zu lernen, weil es dann später einfacher für dich ist, andere Sprachen zu lernen. Das heißt es oft für Latein. Klar, man lernt beim Lateinlernen den Umgang mit verschiedenen grammatikalischen Konzepten und erarbeitet sich einen Grundwortschatz, der in vielen anderen Sprachen ebenfalls vorhanden ist. Ob das aber als Motivation für das Lernen genug ist? Für eine Sprache, mit der ich direkt in der modernen Welt wenig anfangen kann? Weil ich irgendwann vielleicht einmal Italienisch lernen möchte?
Meine Meinung: Wenn du Italienisch lernen willst, dann lern doch Italienisch! Das geht auch ohne Latein. Wenn du gar nicht Latein lernen willst, ist es doch Zeitverschwendung, erst Latein zu lernen und danach erst Italienisch.
Nah verwandte Sprachen
Ebenfalls zum Thema Schwierigkeit der Sprache gepaart mit Praktikabilität wird häufig folgende Überlegung genannt: Diese Sprache wäre praktisch zu lernen, weil du schon diese andere Sprache gelernt hast und du ganz viel übertragen kannst, denn die Sprachen sind so nah verwandt.
Hierzu möchte ich lediglich anmerken, dass die nahe Verwandtschaft zweier Sprachen nicht unbedingt hilft. Aus eigener Erfahrung kann ich berichten, dass die automatische passive Verständlichkeit beim Lesen und ebenso die ähnliche bzw. teils identische Grammatik zwar hilfreich sein können. Die Nähe der Sprachen zueinander kann jedoch auch verwirren und dazu führen, dass man keine der beiden Sprachen souverän spricht.
Bei Französisch und Italienisch habe ich kaum Probleme gehabt. Ich habe lediglich die ganzen kleinen Wörter, die gleich sind und dann irgendwie doch nicht, andauernd vertauscht. Das lag aber sicher auch daran, dass ich ständig hin- und herwechseln musste, da die Lehrveranstaltungen an der Uni stets direkt aufeinander folgten.
Dänisch lernen fiel mir am Anfang unnötig schwer, da ich das Schwedisch in meinem Kopf nicht abschütteln konnte. Da half es auch nicht, dass ich beim Lesen schon fast alles verstanden habe, bevor ich überhaupt angefangen hatte, Dänisch zu lernen. Mein größtes Thema war die Aussprache. Ich konnte gefühlt nichts sagen, was auch nur annähernd Dänisch klang. Um dieses Problem zu lösen, musste ich Schwedisch für einige Zeit komplett beiseite legen. Außerdem habe ich sehr viel Zeit in die dänische Aussprache gesteckt (was bei der aussprachelastigen Sprache Dänisch aber für jeden gut investierte Zeit ist).
Fazit für das Kriterium Schwierigkeit: Netter Bonusgrund.
Auch beim Thema ‚Wie schwierig ist die Sprache zu lernen?‘ lassen sich zwar Argumente finden. Sie reichen jedoch nicht aus, um für eine Motivation zu sorgen, die dich langfristig trägt. Es kann ganz toll sein, wenn du aus gutem Grund eine bestimmte Sprache lernen willst und sie dann auch noch „leicht“ zu lernen ist oder du gut auf eine andere, bereits gelernte Sprache zurückgreifen kannst. Der Schwierigkeitsgrad sollte dich jedoch nicht von deiner persönlichen Traumsprache abhalten.
4. Dein ganz persönliches Warum
Du hast es dir natürlich schon gedacht, worauf es aus meiner Sicht bei der Sprachauswahl ankommt:
Welche Sprache passt genau zu dir? Welche Sprache ist richtig für dich? Je individueller du die Frage beantworten kannst, desto besser.
Ein paar Ideen: Weil du die Sprachmelodie schön findest. Weil du findest, dass die Wörter schön aussehen. Weil die Sprache bestimmte Features hat, die du als Sprachnerd großartig findest.
Für den Anfang reichen diese Gründe sicher. Meiner Erfahrung nach geht es erst einmal um Interesse und Neugier. Ein weiterer Aspekt, der im Laufe des Lernens immer wichtiger wird, ist, dass es nicht nur um die Sprache selbst geht, sondern um ihr „Drumherum“ und wofür du sie nutzen willst.
Beispiele hierfür: Weil du Menschen kennst, mit denen du die Sprache sprechen willst. Weil du dich in einem anderen Land integrieren willst. Weil dich die Kultur und Geschichte einer Region interessieren.
Zusammengefasst:
Entscheide dich für eine bestimmte Sprache, weil du persönlich etwas in ihr siehst, was es für dich ganz persönlich wert macht, sie zu lernen.
Manchmal lässt sich das auch schwer ausdrücken oder anderen Menschen erklären (was du zum Glück auch gar nicht musst!). Es reicht völlig aus, wenn irgendetwas in dir drin sagt, dass sich das mit dieser Sprache einfach gut anfühlt.
Und pssst: Wer sagt eigentlich, dass es nur eine Sprache sein darf, die du lernst? Das können doch auch zwei oder mehr sein. Und ja: Es ist möglich, mehrere Sprachen gleichzeitig zu lernen! Es ist ja nicht so, dass man erst einmal eine Sprache „fertig“ lernt, und dann erst eine weitere angehen kann. Wie immer kommt es aber darauf an, ob und wie es für dich individuell passt!
Einen interessanten Artikel als Inspiration zum gleichzeitigen Lernen mehrerer Sprachen, inkl. Tipps zum Thema Zeitmanagement und einem eigenen Ansatz zur Sprachauswahl, findest du auf dem Fluent in 3 months-Blog (ohnehin ein toller Blog für Sprachliebhaber!).
5. Änderungen sind möglich und in Ordnung!
Dein persönliches Warum oder dein Interesse kann sich auch ändern. Oder du stellst fest, dass es eigentlich nie da war. Oft ist das der Fall mit Sprachen, die wir uns gar nicht wirklich selbst ausgesucht haben, z.B. in der Schule, in der das Sprachangebot eingeschränkt war und es eher die Wahl des kleineren Übels war.
Hierüber redet natürlich so gut wie niemand. Jedenfalls habe ich hierzu noch nichts gelesen. Es ist ja auch nicht so schön, öffentlich zu sagen, dass etwas nicht so toll läuft, wie alle denken. Deshalb plaudere ich für euch an dieser Stelle etwas aus dem Nähkästchen:
Ich habe mich für viele Jahre auf romanische Sprachen konzentriert und es hat recht lange gedauert, bis ich gemerkt habe, dass ich einfach keinen ausreichenden Bezug zu ihnen habe. Und es hat noch viel länger gedauert, bis ich mir selbst erlaubt habe, mit ihnen „aufzuhören“. Natürlich heißt das nicht, dass ich sie überhaupt nicht mehr kann, es bedeutet lediglich, dass ich mir keinen Stress mehr mache, ganz dringend mal wieder ein Buch auf Französisch finden zu müssen (was ich dann am Ende sowieso nicht lese). Ich plane auch keine Urlaube nach Italien, „um mein Italienisch aufzufrischen“.
Es ist völlig ok, nicht mit einer Sprache aktiv weiterzumachen oder sie krampfhaft aufrechtzuerhalten, auch wenn man schon sehr viel Zeit und Energie hineingesteckt hat (in meinem Fall habe ich beide Sprachen mehrere Semester studiert).
Das, worauf es ankommt, ist:
1. Zu erkennen, dass es nicht passt.
2. Zu akzeptieren, dass es nicht passt.
3. Konsequenzen daraus ziehen.
Gerade beim zweiten Punkt habe ich persönlich sehr lange gebraucht, weil ich es auch nicht wirklich wahrhaben wollte (hello sunk costs!). Zugespitzt hat es sich schließlich, als ich in Paris gewohnt habe und einsehen musste, dass mein Herz einfach woanders hingehört.
Ein Jahr später wohnte ich dann in Stockholm – und war angekommen. Vom ersten Tag an. Einfach so.

Als ich mich anderen Sprachen zugewendet habe, habe ich den Unterschied sehr deutlich gemerkt: Die Motivation ist eine völlig andere. Ich habe einfach gefühlt, dass es passt. Allein dadurch ging vieles sehr viel leichter und mit mehr Spaß.
Fazit
Wichtig ist aus meiner Sicht, dass man auf das eigene Gefühl hört – egal, was andere sagen oder wie viel „Sinn“ eine Sprache nach außen macht. Und dass man sich nicht unnötig limitiert, nur weil man irgendwann einmal eine Entscheidung anders getroffen hat. Zu diesem Zeitpunkt hatte man ja nicht den gleichen Wissensstand oder das gleiche Bewusstsein wie später.
Es ist wichtig, im Blick zu behalten, dass man seine Entscheidungen ändern darf, jederzeit! Ich bin überzeugt, es geht darum, immer ein Stückchen mehr zu sich selbst zu finden, rauszufinden, wohin man wirklich gehört und wohin man will – und dann kommt der Rest, auch eine neue Sprache, quasi von allein.
